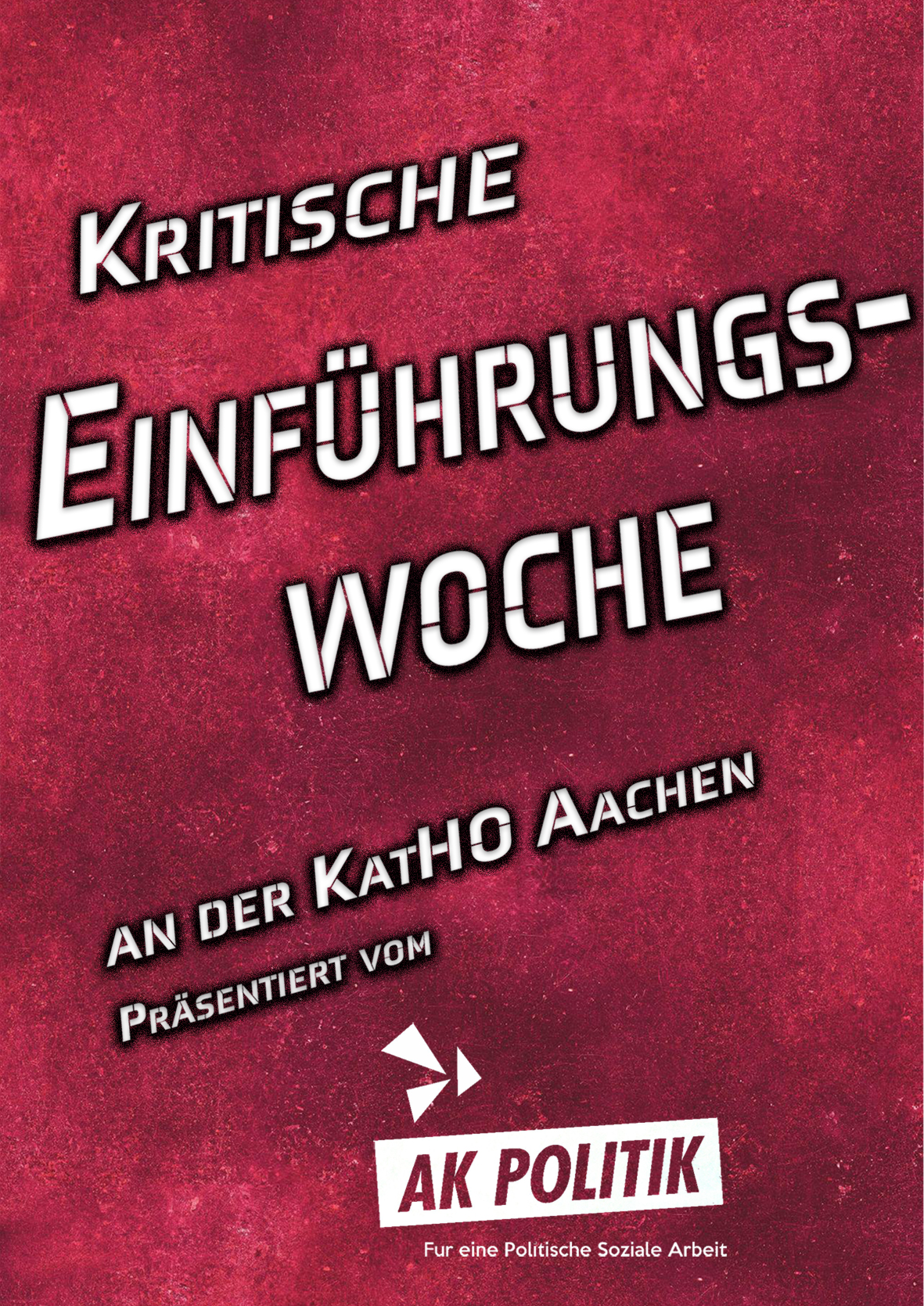Ein hoch auf die Arbeit!
Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, wird wieder der Ruf nach „Arbeit für alle!“ ertönen und auch innerhalb der Linken, zumindest der gewerkschaftlichen, scheint der größte Skandal nicht das Ausbeutungsverhältnis im Kapitalismus, sondern, dass der Kapitalismus nicht für jeden einen Arbeitsplatz bereithält. Arbeitsplätze sollen demokratisiert werden und die Lohnarbeit eine Erfüllung bringen. Zur gleichen Zeit verklären sich auf Lenin, Bebel und ähnliche orthodox marxistischen Denker beziehende Linke anstrengende (körperliche) Arbeiten und die sie ausführenden Arbeiter*innen zu ihrem revolutionären Subjekt. Dabei sind sie dafür blind, wie Subjekte innerhalb dieser Verhältnisse zugerichtet werden, und dass ihre Verklärung wenig Revolutionäres oder gar Befreiendes hat. Alle sollen wir arbeiten, denn schon Luther und die Bibel wussten, dass wer nicht arbeitet auch gefälligst nicht Essen soll. Auf der Grundlage einer solchen christlichen Idee sollen die Arbeiter*innen gefälligst nicht murren, während Friedrich Merz zusammen mit der SPD dem acht Stunden Tag zu Leibe rücken will. Schließlich können doch auch an dieser Stelle für Arbeitnehmer*innen und -geber*innen Potenzial liegen.
Von Schlechten Mächten wunderbar geborgen? Oder von gemachten Verhältnissen umgeben?
Bei all diesen Debatten erscheint die Lohnarbeit im Kapitalismus als etwas Natürliches, Unausweichliches und weniger als etwas von Menschen-Gemachtes und somit als etwas Gewordenes. Vergessen ist die Geschichte des Kapitalismus und die ursprüngliche Akkumulation, die (Lohn-)Arbeit, wie wir sie heute kennen, und die Gewalt, die zu ihrer Etablierung notwendig war, hervorbrachte. Diese ursprüngliche Gewalt führte zum „doppelt freien Arbeiter“, er ist einerseits frei von Produktionsmittel, hat also nur seine Arbeitskraft anzubieten, und frei mit jedem ein Arbeitsvertrag einzugehen, um seine Arbeitskraft für seinen Lebensunterhalt zu veräußern.
Der Arbeitsvertrag wird auch in Zeiten zunehmender Arbeitslosigkeit und Prekarisierung nicht in Frage gestellt, sondern das Unterschreiben von jenem erscheint als fast religiöser Akt. Gott sei Dank, man gehört zum produktiven Teil der Gesellschaft. Adorno weist darauf hin, dass der Arbeitsvertrag wie ein Segen wirkt. Dieser ist nicht wie im religiösen Sinne ideell, sondern materiell. Die Auszahlung des Lohns zum Beginnen eines jeden Monats, die mit dem unterschriebenen Arbeitsvertrag einhergeht, ermöglicht den Konsum, mit welchem sich die Menschen selbst erhalten müssen.
Zur gleichen Zeit bildet jener die Grundlage eine Vergleichbarkeit der Menschen untereinander. Diese abstrakte Gleichheit schafft eine konkrete Ungleichheit, denn nicht alle Tätigkeiten werden in der Gesellschaft gleich entlohnt. So erscheint die Tätigkeit eines Managers wichtiger als die einer Reinigungskraft. Unter diesem Prinzip der Gleichheit entwickeln Menschen das, was Adorno mit Lukács ein „notwendig falsches Bewusstsein“ nennt. Es ist falsch, weil es eine falsche Deutung der Realität darstellt, und notwendig, weil es der falschen gesellschaftlichen Realität entspricht, innerhalb ihr Sinn ergibt und Menschen dieses Bewusstsein entwickeln müssen, um im Bestehenden überleben zu können.
Die Grundlage des „notwendig falschen Bewusstseins“ ist eine Erfahrung von Entfremdung, die alle Menschen in unserer Gesellschaft machen. Diese Erfahrung hat vier Dimensionen. Arbeiter*innen stellen Güter her, die ihnen nicht gehören und ihnen äußerlich sind. Sie sind entfremdet von dem Produkt ihrer Arbeit. Das von ihnen Produzierte dient nicht der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse, sondern der Mehrwertproduktion ihres Arbeitgebers. Sie sind von ihrer Tätigkeit innerhalb der Arbeit entfremdet. Arbeit als entfremdete Tätigkeit verändert das Bewusstsein und die Bedürfnisstruktur der einzelnen Individuen. Im Kapitalismus arbeiten Menschen, um in ihrer Freizeit zu konsumieren und sich so zu erhalten. Der Mensch entfremdet sich von sich als Menschen. Diese drei Entfremdungserfahrungen führen dazu, dass die Menschen sich selbst, ihre Umwelt und ihre Mitmenschen als Waren[1] , also als käuflich, und Elemente des Kapitalismus wahrnehmen. Das Kapitalverhältnis wird als ein natürliches wahrgenommen. Es erscheint ihnen als ein Verhältnis von Dingen und nicht wie das von Menschen. Die Arbeiter*innen entfremden sich von einander.
Die Art und Weise wie Menschen sich zu einander in Verhältnis setzen, hat Auswirkungen darauf, wie wir leben, lieben, streiten und kämpfen. Am Beispiel von feministischen Kämpfen lässt sich diese Misere, in der wir stecken, gut verdeutlichen. Wenn heute von der Befreiung der Frau gesprochen wird, so ist damit nicht die Emanzipation der Frau aus den Verhältnissen heraus gemeint. Vielmehr versteht man darunter eine Gleichstellung zwischen Männer und Frauen in den Verhältnissen, was lediglich bedeutet, dass beide in erster Linie Arbeitskraftbehältnisse sind. Frauen wie Männer sollen gleich im Produktionsprozess ausgebeutet werden. Dazu müssen Frauen zumindest teilweise von den Zwängen der Küche und des Kindes befreit und den Zwängen der Lohnarbeit zugeführt werden. Dementsprechend fokussieren sich Forderungen, die einer solchen feministischen Idee entsprungen sind, auf die Schaffung von möglichst langen außerhäuslichen Betreuungsmöglichkeiten von Kindern und der Förderung von sogenannten familienfreundlichen Unternehmen. Schließlich braucht der Kapitalismus auch neue Arbeitskräfte, die geboren und erzogen werden wollen. Die Vereinbarung von Familie und Beruf stellt zur gleichen Zeit für viele Frauen bei immer niedrigeren Reallöhnen und zunehmenden Lebensunterhaltskosten eine Notwendigkeit dar.
Weg mit der Arbeit!
So ist der Ruf nach Arbeit, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, verständlich. Er ist eine moralische Empörung über die Verhältnisse, die Menschen in einem Mangel leben lassen, aber er stellt bei weitem noch keine Kritik an eben diesen Verhältnissen dar. Wenn eben diese Verhältnisse aufgehoben werden sollen, „in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“, muss der Mensch auch von der Lohnarbeit befreit werden. Das Ziel des Menschen ist nicht die Arbeit, sondern die Muße, wie Oscar Wild es bereits formulierte. Denn nur in der Muße kann der Mensch, frei von allen Zwängen, anfangen über sich und sein Geworden-Sein in der Welt nachzudenken und die Grundlage für eine bessere Gesellschaft zu schaffen.

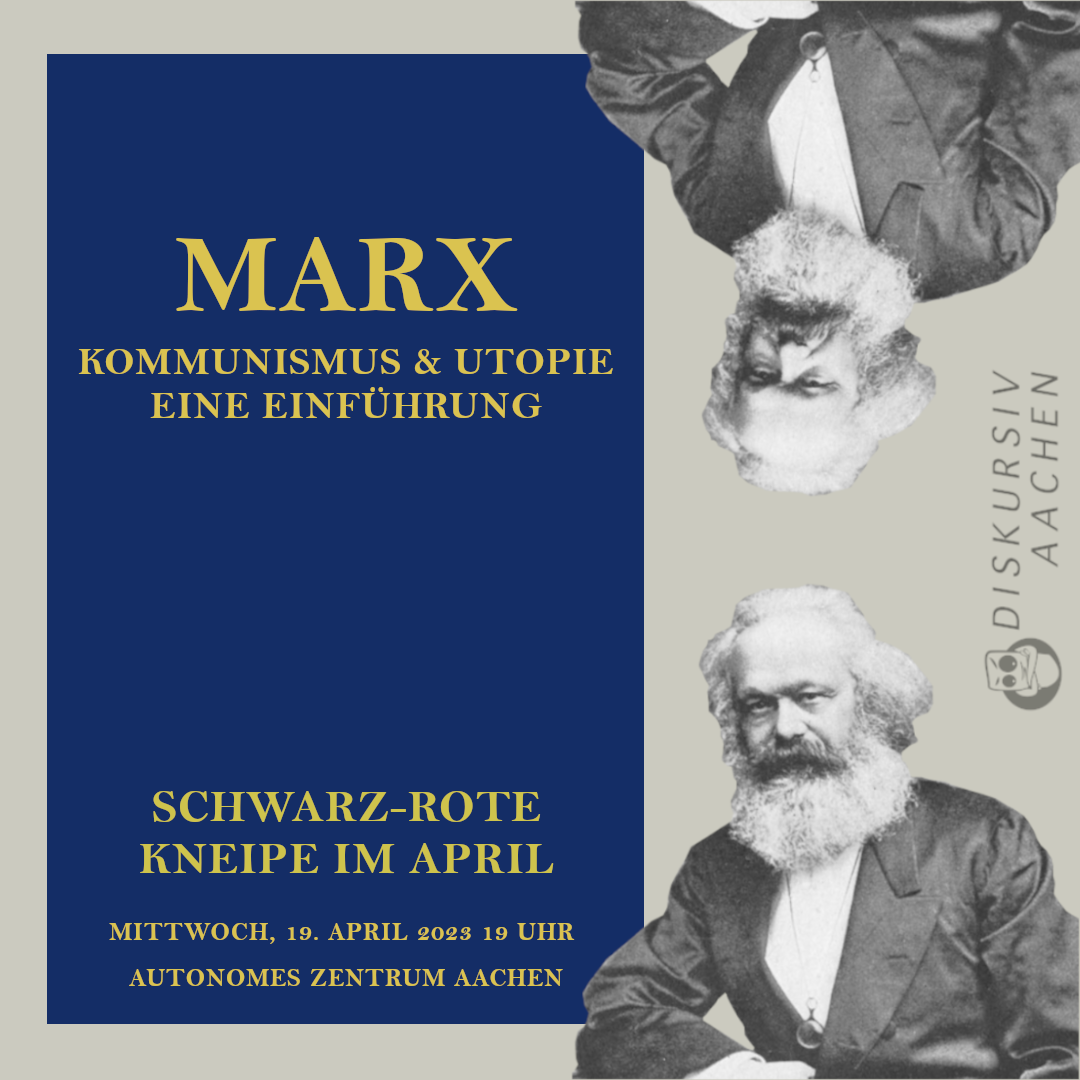 Irgendwann in der politischen Sozialisation innerhalb linker Strukturen trifft man auf Karl Marx.
Irgendwann in der politischen Sozialisation innerhalb linker Strukturen trifft man auf Karl Marx. Der Vortrag findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe ‘Another world is possible’ des SDS Aachenstatt. Es soll in die marxsche Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie eingeführt werden.
Der Vortrag findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe ‘Another world is possible’ des SDS Aachenstatt. Es soll in die marxsche Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie eingeführt werden.